Sie sind hier: Startseite > Nebennieren > Cushing-Syndrom
Cushing-Syndrom: Diagnose und Therapie des Hyperkortisolismus
Definition des Cushing-Syndroms und des Morbus Cushing
Das Cushing-Syndrom ist ein Symptomenkomplex, der durch einen Überschuss an Glukokortikoiden (Hyperkortisolismus) ausgelöst wird. Als Morbus Cushing wird ein Hyperkortisolismus bezeichnet, der durch einen ACTH-produzierenden Hypophysentumor ausgelöst wird.
Epidemiologie
Prävalenz 5–6/100 000, Verhältnis Frauen zu Männer beträgt 3:1, Erkrankungsbeginn 30–50 Jahre.
Ätiologie (Ursachen) des Cushing-Syndroms
Überproduktion von ACTH:
- Hypophysenadenom (Morbus Cushing)
- ektope ACTH-Produktion bei Bronchialkarzinom, Pankreaskarzinom, Bronchialkarzinoid.
- ektope paraneoplastische CRH-Produktion (Rarität)
ACTH-unabhängig:
- Nebennierenadenom oder Karzinom mit Überproduktion von Kortison
- iatrogen durch Steroidmedikation
- mikronoduläre Hyperplasie der Nebennieren
- ektope Kortisolproduktion (Rarität, paraneoplastisch)
Klinik des Cushing-Syndroms
- Stammfettsucht, Vollmondgesicht
- arterielle Hypertonie
- Diabetes mellitus
- Muskelschwäche, Muskelatrophie
- Menstruationsstörungen
- Striae rubrae, Akne, Ödem
- Psychische Veränderungen, Kopfschmerzen
- Hyperpigmentierung der Haut ist typisch bei Überproduktion von ACTH (aus POMC).
Labor-Diagnose des Cushing-Syndroms
Nächtlicher Cortisol-Speicheltest:
Das Diagnostikum der Wahl zur Bestätigung eines Hyperkortisolismus ist der nächtliche Speicheltest mit Bestimmung von Cortison und Cortisol im Speichel zwischen 23 und 24 Uhr. Der Speicheltest ist einfacher und zuverlässiger als die Kortisolbestimmung im 24 h-Sammelurin.
Kortisol im Urin:
Bestimmung der Kortisolkonzentration im 24 h-Sammelurin, eine Alternative zum Speicheltest.
Serum-Kortisol:
Konzentration morgens und abends: Nachweis des Verlustes der physiologischen Tagesschwankung. Normwert morgens um 8 Uhr 4–22 μg/dl.
ACTH-Konzentration im Serum:
Werte unter 5 pg/ml weisen auf ein ACTH-unabhängiges Cushing-Syndrom hin, Werte über 50 pg/ml sprechen für ein ACTH-abhängiges Cushing-Syndrom.
Dexamethason-Hemmtest:
Die Gabe von Dexamethason führt zu einer Absenkung des morgendlichen Serum-Kortisols.
Dexamethason-Kurztest:
Als Ausgangswert dient die morgendliche Serum-Kortisol-Konzentration. 1 mg Dexamethason p.o. am Abend führt normalerweise zu einer Absenkung des Plasmakortisols am nächsten Morgen auf <1,8 μg/dl, ein Cushing-Syndrom ist unwahrscheinlich. Bei unzureichender Suppression wird der Dexamethason-Hemmtest in höherer Dosis wiederholt.
Dexamethason-Suppressionstest (hohe Dosis):
Als Ausgangswert dient die morgendliche Serum-Kortisol-Konzentration, abends 8 mg Dexamethason p.o. Am nächsten Morgen wird wieder die Serumkonzentration von Kortisol bestimmt.
Interpretation des Dexamethason-Hemmtest
- Keine Suppression und niedriges ACTH: adrenales Cushing-Syndrom
- Keine Suppression und normales/hohes ACTH: ektope ACTH-Produktion oder Morbus Cushing
- Suppression nur mit höchster Dosis und normales/hohes ACTH: Morbus Cushing sollte noch in Betracht gezogen werden (Bildgebung, CRH-Test).
- Suffiziente Suppression: Cushing-Syndrom unwahrscheinlich
Metyrapon-Test:
Der Metyrapon-Test differenziert zwischen ACTH-Sekretion aus der Hypophyse oder ektoper Produktion. Metyrapon (Metopiron) blockiert die 11–beta-Hydroxylase und damit die Vollendung der Kortisolbiosynthese. Als Zwischenprodukt wird vermehrt 17-Hydroxykortikosteroid im Urin nachgewiesen, da (bei intakter Rückkopplung über die Hypophyse) das ACTH ansteigt und die Biosynthese von Glukokortikoiden gesteigert wird. Bei ektopen ACTH-produzierende Tumoren fehlt diese Rückkopplung, die Zwischenprodukte im Urin steigen nicht an.
CRH-Test:
Die abendliche Gabe von CRH (1 μg/kgKG i. v.) führt zum Anstieg von ACTH und Kortisol innerhalb von 30 min. ACTH und Cortisol werden vor CRH-Gabe und nach 15, 30, 60 und 90 Minuten bestimmt.
- Bei Morbus Cushing: erhöhtes basales ACTH und erhöhtes basales Kortisol. Deutlicher Anstieg von ACTH oder Kortisol.
- Bei adrenalem Hypercortisolismus: supprimiertes basales ACTH und erhöhtes basales Kortisol. Kein überschießender Anstieg von ACTH oder Kortisol.
- Bei ektoper ACTH-Produktion: erhöhtes basales ACTH und Kortisol. Kein überschießender Anstieg von ACTH oder Kortisol.
Selektive simultane Blutentnahme von ACTH:
Aus dem rechten und linken Sinus petrosus inferior zur Lokalisation des Hypophysenadenoms. Blut wird vor und nach der Stimulation mit CRH abgenommen.
Bildgebung in der Diagnose des Cushing-Syndroms
Kraniales CT oder MRT:
Bei V. a. Morbus Cushing zur Diagnose eines Hypophysentumors.
CT oder MRT-Abdomen:
Bei V. a. Nebennierenadenom/karzinom. In der Regel sind hormonproduzierende Adenome größer als 2 cm und die Nebenniere der Gegenseite ist atrophiert. Nebennierenkarzinome sind oft größer als 5 cm und zeigen Verkalkungen oder Unregelmäßigkeiten.
Therapie des Cushing-Syndroms
Therapiegrundsätze:
- Normalisierung der Kortisolproduktion
- Entfernung lebensbedrohlicher Tumoren
- Vermeidung einer Hormoninsuffizienz
- Vermeidung einer lebenslangen Abhängigkeit von einer (Hormon)-Medikation
Therapie des Morbus Cushing:
Die Methode der Wahl ist die transsphenoidale Entfernung des Hypophysenadenoms. In 10% droht ein Rezidiv. Bei Rezidiv oder fehlender OP-Möglichkeit ist eine Hypophysenbestrahlung möglich, evtl. in Kombination mit der einer medikamentösen Therapie: Optionen sind Pasireotid (Somatostatin-Analogon), (Levo)Ketoconazol, Osilodrostat oder Metapyron (Blockung der Steroidsynthese) oder Mifepriston (Glucokortikoidrezeptorantagonist).
Bei Versagen von o.g. Therapieoptionen ist die beidseitige Adrenalektomie und anschließende lebenslange Substitution der Nebennierenhormone in physiologischer Dosierung möglich. Eine Komplikation nach beidseitiger Adrenalektomie ist das Nelson-Syndrom: der ACTH-produzierende Hypophysentumor proliferiert und verursacht Hyperpigmentierung, Sehstörungen (Kompression des Tractus opticus) und Kopfschmerzen.
Nebennierenadenom/Karzinom:
Entfernung der betroffenen Nebenniere [Adrenalektomie]. Bei metastasiertem Nebennierenkarzinom ist die Therapie mit Mitotane (Derivat eines Pflanzenschutzmittels) eine Option zur Blockung der Hormonproduktion.
Ektope ACTH-Produktion:
Identifizierung des Tumors und Entfernung. Bei fehlender Lokalisation oder Resektionsmöglichkeit ist die medikamentöse Therapie oder die bilaterale Adrenalektomie eine Option (siehe oben).
| Epidermoidzyste Hoden | suchen | Conn Syndrom |
Sachregistersuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Literatur
Boscaro u.a. 2001 BOSCARO, M. ; BARZON, L. ;
FALLO, F. ; SONINO, N.:
Cushing’s syndrome.
In: Lancet
357 (2001), Nr. 9258, S. 783–91
Fleseriu M, Auchus R, Bancos I, et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Dec;9(12):847-875. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00235-7.
 English Version: Hypercortisolism and Cushing syndrome
English Version: Hypercortisolism and Cushing syndrome
Urologielehrbuch.de ohne Werbung
Diese Internetseite ermöglicht mit Hilfe von Werbung den Volltext-Zugriff auf das aktuelle Urologielehrbuch.de. Viele Bilder sind zum Schutz von Laien verpixelt oder ausgeblendet. Regelmäßig wiederkehrende (fachkundige) Leser können die Werbebanner abschalten und Zugriff auf alle Abbildungen erhalten: Werden Sie Mitglied über die Crowdfunding-Plattform Steady und unterstützen Sie damit Urologielehrbuch.de.
Urologielehrbuch.de als Hardcover-Buch
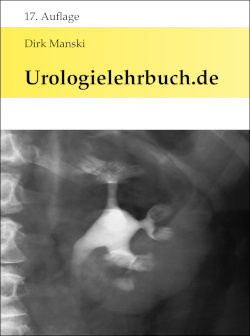 Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.
Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.