Sie sind hier: Startseite > Nieren > Operationen > ESWL
Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL): Technik und Komplikationen
Die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) ist ein technisches Verfahren in der Urologie, das die Zertrümmerung von Harnsteinen durch Stoßwellen ohne Narkose ermöglicht. Die ESWL wurde 1982 in München entwickelt (Chaussy u.a., 2002).
Indikationen zur ESWL
Nierensteine unter 2,5 cm Größe. Weiterhin gut behandelbar sind Harnleitersteine im proximalen Harnleiter, weiter distal sind Ortung und Positionierung der Stoßquelle schwieriger (Bach und Buchholz, 2011).
 |
Kontraindikationen der extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie
Absolute Kontraindikationen zur ESWL:
Pathologische Blutgerinnung, Thrombozytenaggregationshemmer oder -funktionsstörungen, Schwangerschaft, Aortenaneurysma, Nierenarterienaneurysma, unbehandelte Harnwegsinfektion, fehlende Ortbarkeit des Steins (z.B. bei muskuloskelettalen Erkrankungen oder massiver Adipositas).
Relative Kontraindikationen zur ESWL:
Fehlender Urinabfluss (Harnstau), die ESWL auf Harnleitersteine kann auch mit Harnstau erfolgen.
Technische Grundlagen der extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie
Prinzipiell unterscheidet man ESWL-Stoßquellen nach dem Mechanismus der Stoßgenerierung:
Elektromagnetische ESWL:
Ein Stromstoß durch eine Spule bewegt eine Membran, vergleichbar mit einem Lautsprecher. Durch eine Art Linsensystem wird diese Stoßwelle gebündelt und fokussiert. Beispiele: Doli von Dornier, Lithostar von Siemens.
Elektrohydraulische ESWL:
Eine Funkenentladung einer Zündkerze im Wasser erzeugt eine Stoßwelle, die an einem Ellipsoid reflektiert und dadurch gebündelt und fokussiert wird. Beispiel: HM3 von Dornier.
Piezoelektrische ESWL:
Inverser piezoelektrischer Effekt: ein Kristall wird durch die Anlage einer elektrischen Spannung mechanisch verformt und erzeugt einen mechanischen Impuls. Die Kristalle sind entlang eines Ellipsoids ausgerichtet, dies ermöglicht die Fokussierung der Stoßwelle. Beispiel: Piezolith von Wolff.
Technische Durchführung der ESWL
Voraussetzungen für eine extrakorporale Stoßwellenlithotripsie:
- Der Urinabfluss sollte gewährleistet sein. Bei großen Konkrementen ist die vorherige Einlage einer DJ-Harnleiterschiene zu bedenken. Die ESWL auf (kleine) Harnleitersteine kann auch mit Harnstau erfolgen.
- Gerinnung und Thrombozytenfunktion im Normbereich
- Steriler Urin, eine Antibiotikaprophylaxe ist nicht notwendig
- Normaler Blutdruck
- Patient ist aufgeklärt
- Stein kann geortet werden
- Blasenfreie Ankopplung der Stoßquelle mit reichlich Gel
Überwachung des Patienten:
Während der ESWL sollten die Sauerstoffsättigung, das EKG und der Blutdruck überwacht werden.
Analgesie:
Je besser die Analgesie, desto ruhiger liegt der Patient und desto höher ist die Trefferrate und die Steinfreiheit nach ESWL. Das Minimum ist eine Analgosedierung mit z. B. Midazolam und Piritramid.
Ortung:
Ortung des Steins mit Ultraschall, Durchleuchtung oder beidem. Während der Behandlung muss die Ortung regelmäßig überprüft werden, da die Patienten sich häufig schmerzbedingt bewegen.
Dosierung:
2000–4000 Stoßwellen werden mit einer Frequenz von 60–120/min abgegeben. Vergleichende Studien fanden eine höhere Effektivität der ESWL bei niedrigerer Frequenz der Stoßwellen (60 vs. 120/min). Stoßwellen erzeugen im Fokusgebiet mikroskopisch kleine Kavitationsblasen, die schnell spontan wieder zerfallen. Bei zu schneller Abfolge der Stoßwellen verpufft die Energie an den Kavitationsblasen und nicht am Nierenstein.
Die Stärke der Stoßwellen wird schrittweise nach dem Schmerzempfinden oder nach dem gerätespezifisch empfohlenen Maximalwert eingestellt. Zwischen den einzelnen Behandlungen sollten möglichst mehrtägige Pausen eingehalten werden.
Nachsorge nach ESWL
Kontrolle der Niere auf Steinfreiheit, Harnstau oder Hämatombildung mit Röntgenaufnahmen und Sonographie. Unterstützung des spontanen Desintegratabgangs mit NSAR (z.B. Diclofenac 75 mg 1-0-1) und Alphablocker (z.B. Tamsulosin 0,4 mg 1-0-0) als Off-Label-Therapie.
 |
Komplikationen nach extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie
Blutdruckabfall:
Hypotonie während der Therapie mit Übelkeit und Erbrechen möglich.
Blutung:
Blutung mit retroperitonealem Hämatom. Das Ausmaß der Nierenschädigung ist abhängig von der Anzahl der Stoßwellen und deren Energie, der Fokusgröße und der Steinlokalisation. Risikofaktoren des Patienten für ein retroperitoneales Hämatom sind Gerinnungsstörungen, Thrombozytenfunktionsstörungen, Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern (ASS) oder ein arterieller Hypertonus. Sehr selten kann ein Pseudoaneurysma der Nierenarterie entstehen.
Harnstau:
Fehlender Desintegratabgang mit Steinstraße im Harnleiter führt zur Koliken und Harnstau.
Infektionen:
Fieber, Urosepsis, insbesondere bei Harnstau.Nierenfunktionsverlust:
Durch die Kombination der oben genannten Komplikationen ist im Verlauf der Funktionsverlust der Niere möglich, sehr selten ist eine Nephrektomie erforderlich.
| Perkutane Nephrolithotomie | Suchen | Ureterorenoskopie |
Sachregistersuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Literatur
Bach, C. & Buchholz, N.
Shock wave lithotripsy
for renal and ureteric stones
Eur Urol Suppl, 2011,
10, 423-432.
Chaussy u.a. 2002 CHAUSSY, C. ; SCHMIEDT, E. ;
JOCHAM, D. ; BRENDEL, W. ; FORSSMANN, B. ;
WALTHER, V.:
First clinical experience with extracorporeally induced destruction
of kidney stones by shock waves. 1982.
In: J Urol
167 (2002), Nr. 5, S. 1957–60
Lawler AC, Ghiraldi EM, Tong C, Friedlander JI. Extracorporeal Shock Wave Therapy: Current Perspectives and Future Directions. Curr Urol Rep. 2017 Apr;18(4):25. doi: 10.1007/s11934-017-0672-0.
Setthawong V, Srisubat A, Potisat S, Lojanapiwat B, Pattanittum P. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Aug 1;8(8):CD007044. doi: 10.1002/14651858.CD007044.pub4.
 English Version: extracorporeal shock wave lithotripsy
English Version: extracorporeal shock wave lithotripsy
Urologielehrbuch.de ohne Werbung
Diese Internetseite ermöglicht mit Hilfe von Werbung den Volltext-Zugriff auf das aktuelle Urologielehrbuch.de. Viele Bilder sind zum Schutz von Laien verpixelt oder ausgeblendet. Regelmäßig wiederkehrende (fachkundige) Leser können die Werbebanner abschalten und Zugriff auf alle Abbildungen erhalten: Werden Sie Mitglied über die Crowdfunding-Plattform Steady und unterstützen Sie damit Urologielehrbuch.de.
Urologielehrbuch.de als Hardcover-Buch
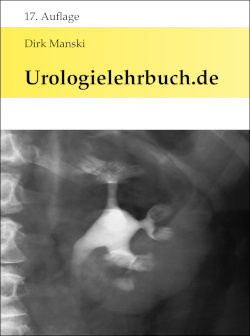 Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.
Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.